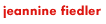Made in England oder als Pathosformel:
Diese Narbe (= scar) unserer Sehnsucht bleibt ewig unverschlossen
Sei wie ein Hase – beweglich, behende, immer auf der Hut. Das Hakenschlagen bewies sich bislang als lebensrettend: 2005 war es knapp, denn nur zwei Tage nach den Attentaten auf Busse und Bahnen traf ich am 9. Juli in London ein. Zischler hatte mich beauftragt, am British Film Institute über ein Kinoprogramm zu recherchieren, das James Joyce lange vor seinem Weltruhm in Dublin zusammengestellt hatte.
Anfang Mai 2017 waren wir glücklich 26 Tage zu früh unterwegs. Wollten wir doch eben jene Brücke überqueren, die am 3. Juni zum aleatorischen Tatort der Gotteskämpfer wurde – ja, richtig, sie würfeln die Plätze für ihre Massaker aus! –, um die Privatsammlung eines obercleveren Produzenten zu besichtigen, dessen eigentliches Gesamtkunstwerk sich in der Nachschau als punktgenaue Bespielung kapitalistischer Marktmechanismen erweisen wird:
"My dear, first, I will quench your thirst 'cause I'm THE Hirst! Second, as you might reckon, I'm the market's prime, fuck the sublime asf."
It's such a peek-a-boo trade. – Hirst as the worst case of contemporary art!
Doch dies ist ein anderes Feld, und wir schafften es aus Zeitgründen ohnehin nicht über die Brücke ans Südufer der Themse nach Lambeth, wo Damien Hirst vor einigen Jahren in ausrangierten Fabrikhallen ein Privatmuseum eröffnet hat.
Aber immer der Reihe nach.
Die Initialen sind dieselben, nur verbirgt sich hinter ihnen diesmal eine ganze Milchstraße an künstlerischen Möglichkeiten: David Hockney und sein Werk waren Dreh- und Angelpunkt unserer Reise nach England. Vom Angeln reden, heißt vom Ködern fachsimpeln: Wir "köderten" mit unseren nicht enden wollenden Elogen auf Hockney und sein grandioses Spätwerk Familie Asendorf-Moser, uns zu begleiten, zumindest nach London, um dort an einem der letzten Wochenenden die Hockney-Schau in der Tate Britain zu besuchen. Von den appellativen Befreiungsschlägen der frühen 1960er bis hin zu den digitalen Farbexplosionen der Smartphone- und Tabletmalereien der Gegenwart beherrscht Hockney sämtliche Register der modernen Malerei. Die Schau, trotz Zeitfenster-Reglements schon morgens mit regem Zulauf gesegnet, spannte den Bogen seines über sechzig Jahre alten Oeuvres. Einem animierten Publikum wurden die beiden Hauptinteressen Hockneys bei schöner Hängung und Farbgebung der Säle anschaulich gemacht: die FARBEN und der Lauf der ZEIT.
Während das Farbspektrum von erdigen, verhaltenen Tönen im Frühwerk mit der ersten kalifornischen Periode aufbricht und über die Pastelltöne seiner Pop Art-Porträts zu den mitreißenden Farbspektakeln der letzten drei Jahrzehnte findet, bahnt sich der Faktor Zeit als zu bearbeitendes Problem langsamer seinen Weg in Hockneys Kunst.
Seine Pool-Gemälde lassen sich als "freeze frames" lesen, die Hogarth-Scharaden breiten sich als Memories zur Raumzeit vor dem Betrachter aus. Und ist nicht jede Porträtserie per se eine malerische Umsetzung der Zeitraffer-Technik? Hockney ist ein großer Zeichner und Beobachter feinster mimischer Abweichungen, dem mit wenigen Strichen anrührende Persönlichkeitsstudien gelingen – von der Mutter, von Lebenspartnern oder intimen Freunden. Er selber bezeichnet die Porträts in Öl genau anders herum als "Langzeitbelichtungen", die eine zuvor festgesetzte Produktionszeit nicht überschreiten dürften. Seine großen Polaroid-Collagen sind Gefäße, die die vergehende Zeit im Sekundentakt speichern und führen in gerader Linie zu den metaphysischen Bilderbögen über den Wandel der Natur durch die Jahreszeiten.
Es gibt vermutlich keinen zweiten lebenden Künstler, der seit den 1980ern neue Medien wie Computer, Faxgerät und andere Apparate zur Kommunikation so konsequent genutzt und den eigenen künstlerischen Ausdruck um deren Bildgebungsverfahren bereichert hat. (Fotografie und Film müssen hier zu den althergebrachten konventionellen Techniken gezählt werden.)
Welch' wunderbare Geste! Seine Freunde erhalten morgens einen Blumenstrauß oder ein Stilleben über das Smartphone! Der Meister beginnt täglich um neun Uhr mit der Arbeit, sieben Tage die Woche. Hockney braucht keine Rast, er lebt in der Gegenwart und schaut nach vorn. Lediglich das "Don't drive drunk" erweitert er für sich zum "No drugs while working, except for nicotine".
(In England wurden mir Streichholzschachteln für ein knappes Pfund angeboten. "Thank you, but no, thank you." Die Zigaretten hatte ich für Notfälle im Gepäck, habe aber keine einzige angezündet. Auch um der Peinlichkeit zu entrinnen, mit anderen Touristen qualmend vor Hotelportalen zu stehen, in deren Blumenkästen Schilder folgenden Inhalts steckten: "We are no ashtrays!")
Wir hatten eine Stippvisite in Bridlington geplant, für die vergangenen fünfzehn Jahre Hockneys Wohn- und Arbeitsort an Yorkshires Nordseeküste. Doch schon am Ankunftstag erfuhren wir von Sandra und Dominic, einer schönen Zufallsbekanntschaft im Design-Museum an der Kensington South, dass er 2016 aus gesundheitlichen Gründen zurück nach Los Angeles gegangen sei.
Kensington war für zweieinhalb Tage unser Londoner "Kiez". Beate Moser und Christoph Asendorf schlugen das K & K Hotel unweit der Piccadilly Line vor – mit der Underground Station Earl's Court (zur Tube wird sie erst zwei Stationen später). Eine wunderbare Empfehlung, denn mit dieser Linie reist der Tourist von Heathrow "without change" direkt in den Citybereich, steigt aus und ist in wenigen Gehminuten in einer dieser traumverlorenen, weiß lackierten Wohnstraßen, deren Höfe zu sich parkähnlichen Anlagen öffnen und die vielen (geldsatten) Boroughs in London den Charme von Gartenstädten verleihen.
Unser viktorianisches Hotel besaß eine gepflegte Anlage. Dank des milden Seeklimas in Südengland gedeihten hier wie an vielen Orten im reichen London Palmengewächse und andere Exoten. Daneben blühten Flieder, Rosen, Pelargonien, Wisteria sowie einige Azaleen- und Rhododendrongewächse. Die weißen und rosaroten Kerzen der Kastanien leuchteten verschwenderisch durch das dichte Grün. Eine mir unbekannte strauchartige, mit enzianblauen Dolden besetzte Pflanze schmückte nicht nur unsere Anlage, sondern ganz Kensington mit ihrer überschäumenden Pracht. Die Hotelgärtnerin schrieb deren Namen in mein Notizbuch: Ceanothus, die Säckelblume, ein immergrünes botanisches Zauberwesen. Da war sie – die blaue Blume der Romantik! Wir fanden sie in unserer Hotelkette, einer spätkapitalistischen Exklave von Habsburger Entrepreneuren.
Das "My home is my castle" ließe sich spielend auf ein "And my garden is my kingdom" erweitern, denn der Brite ist vor jeder anderen Berufung tief in seinem Herzen Gärtner – wie angesichts großartig konzipierter Anlagen vor Privathäusern oder Hotels neidlos zu attestieren war ... das Wetter, natürlich, gibt es doch in diesem Land den ersten und den letzten Gesprächsstoff her: Es war kaum der Rede wert, besser noch, es war ideal! Frühlingshaft warme Stunden des Nachmittags, einige wenige Sprühregentropfen, die Abende und Morgenstunden eher kühl und die Nächte ebenso wie die Matratzen in eigentlich allen Hotels – unserem Erschöpfungsschlaf zuträglich.
Kulinarisch wurde indessen entschieden dazu gelernt. Hatte schon das Vielvölkergemisch des Commonwealth die fragwürdigen Essgewohnheiten der vereinigten Königstreuen aufs Wunderbarste bereichert, so gelang es der amerikanischen HippieHipsterküche in den vergangenen zwanzig, dreißig Jahren klammheimlich, englische Restaurantküchen zu transfundieren. Junge Leute interessieren sich zwar mehrheitlich kaum noch für Politik, aber sie lassen sich trotzdem nicht alles vorsetzen. Natürlich ist auch das ein politisches Statement. Hängen nicht unendlich viele grüne Themen am Essen? An seinen Zutaten, an der Tierhaltung, an Pestiziden, einer nachhaltigen Landwirtschaft, Lebensmitteltransporten, an fatalen Nahrungsketten, an Ozeanen und am All – gemeinen Schindluder, das wir mit unserer Erde treiben? Dennoch testeten wir hiervon nur wenig. (Selbst Bill Wymans Steakhouse-Kette ließen wir links liegen.)
London war immer teuer, und der Rubel rollt bekanntlich rascher in Restaurants und Geschäfte als ins eigene Portemonnaie. Wir Barbaren von der eurasischen Kontinentalplatte beteiligten uns lieber an der weiteren Überfischung der Nordsee und frönten fast ausschließlich dem englischen Nationalgericht: "fish and chips" in allen Salzwasser-Varianten und Kartoffelsorten, die der heimische Markt hergab –und das ohne einen Hauch schlechten Gewissens. Kurzerhand veränderten wir die Präposition der Pompadour und sagten "hinter uns die Sintflut", nämlich jene, welche vor einigen hunderttausend Jahren das Kreidegebirge zwischen Calais und Dover mit ihren ungeheuren Wassermassen aus schmelzenden Gletschern ausspülte und die Insel abtrennte vom Festland. Unendliche Marschen, das Doggerland, erleichterten noch lange danach die Besiedlung vom Festland aus. Erst seit einem entwicklungsgeschichtlichen Atemzug von circa achttausend Jahren ist das Albion vollends meerumspült. Was schließlich jenen sagenhaften Wesenszug unserer Verwandten zu Tage förderte, den sie selber später als "spleen" bezeichneten und einem Zustand der gewollten Abschottung (alles nördlich des Hadrianswalls, alles außerhalb der Küsten) dienlich war, den sie mit "splendid isolation" glorifizierten.
Eigentlich gehören wir also zusammen, essen, was Meere und Flüsse, Wälder und Weiden den Germanen spenden; sprechen bis heute von Neuburg am Inn bis Newcastle-upon-Thyne in den westgermanischen Dialekten der indoeuropäischen Sprachfamilie; die von uns Deutschen hochverehrte Queen ist ohnehin durch die Sachsen-Coburg-Gotha-Linie teutscher Abstammung – und sind uns doch innigst fremd ... aber auch irgendwie sympathisch. Spätestens seit Berlin nicht mehr Frontstadt sein muss und jeden anlockt, der sich hier amüsieren möchte – na ja, präziser: spätestens seit Willi II seine Cousins auf der Insel nicht mehr mit seinen Marine-Ambitionen nervt und das Reich statt 1000 nur 12 Jahre währte.
Warum sie nun wieder isoliert sein wollen – denn mit allem, nur nicht mit "splendid" möchte man die Situation der Insulaner seit Queen Victorias Tod beschreiben – ist unbegreiflich. Und ihr Hauptargument, die Insel sei zu klein, ist "arrant nonsense".
Hoffentlich kommen sie noch zur Besinnung.
London konnte für uns in der Kürze unseres Aufenthaltes nur the City of London sein. Die Liste der Auslassungen würde kein Ende nehmen – um nur einige zu nennen: die Docklands und der neue Economy District mit seinen Wolkenkratzern sind nach wie vor terra incognita; ein Ausflug nach Greenwich – wie verführerisch auch immer – hätte die Zeitpläne von uns Vieren gesprengt; neue Viertel südlich der Themse wurden, wie eingangs erwähnt, auch noch nicht erobert.
Doch schafften wir als Ouvertüre zur Hockney-Schau "The American Dream. Pop to the Present" im British Museum, dazu Besuche im Victoria & Albert und in der Royal Academy. Zum Bedauern unserer Freunde reichte die Kraft nicht für eine gemeinsame Grand Tour durch die National Gallery – das nächste Mal!
Die Stadt ist wunderschön, abseits des inzwischen monströsen Massentourismus und seiner Trampelpfade, in ihren unbekannteren Museen, Kirchen und Parks, den beschaulichen Mews oder luxuriösen Wohnstraßen – gleichviel ob georgianisch, viktorianisch oder edwardianisch – lässt es sich träumen von anderen Leben, Berufen oder Schicksalsbahnen.
"Ohne Geld läuft nüscht!" In London läuft diesbezüglich deutlich weniger noch als in Berlin, wo sich Lebenshungrige auch 2017 mit bescheidenen Einkünften über Wasser halten können. London hat sein Prekariat weit hinaus in die "outskirts" der Metropole verbannt* (siehe letzte Seite), die man zwischen den Außenposten der Underground aufsuchen müsste, um das Elend von Wohnkasernen und verwahrlosten Reihenhäusern zu entdecken. Aber das macht kein Reisender. Unsere längste Tube-Strecke führte nach Camden Town – vor 20 Jahren ein kunterbuntes Sammelbecken für Künstler, Freaks, Studenten; heute eine abgewrackte Zone von Ramschflohmärkten und Terrassenpubs: Ballermann in London.
Natürlich hat sich die Stadt verändert und selbstverständlich nicht immer zu ihrem Vorteil. Sie ist sauberer geworden, nur besitzt London heute genau jenen abziehbildhaften Glanz all der anderen Sehnsuchtsorte, die man in seinem Leben bereist hat. Wie New York, Paris, Rom, Madrid oder Tokyo präsentiert auch sie an ihren Hauptstraßen den steril-austauschbaren Chic unserer Konsum-Ära. Filmbuchhandlungen in London sind ausgestorben, kleine Läden verschwunden, private Händler aus dem Stadtbild getilgt; und damit auch die Überraschungsmomente, welche einen Besuch in der City zuweilen aufregend machten. In das Apple-Office Building an der 3, Savile Row (nein, es ist nicht der Computer-Gigant gemeint) ist das Kindersortiment von Abercrombie & Fitch eingezogen. (Wenigstens zollen sie meinen vier Helden in einigen Ausstellungskästen einen bescheidenen Tribut.)
Weltweit dieselben Einkaufsketten, Reklame, in der nur die Schriftzeichen ausgetauscht werden; debiles, absolut sinnentleertes TV-Serienfutter in der Hotelglotze; die immer gleichen Klone – Photoshop-generiert oder genormt in Schönheitsfabriken. Die in Demokratien verpönte politische Gleichschaltung hat sich einen ästhetischen Ersatz gesucht.
Der Diversität und Multinationalität preisende Westen giert im Grunde nach Verpuppung und Uniformität. Ein neues Zeitalter des "global streamlining" hat begonnen, obwohl die Lippenbekenntnisse der Politiker und Werber beharrlich anders lauten. Nach den Gesichtsoperationen nun die Zurichtungen der Körper. Alle wollen Beyoncé sein: formschön, kurvig und rasend schnell. Der mephistophelische Bund zwischen Kultur und Kommerz funktioniert nirgends reibungsloser als im globalen Netz von Kosmetik- und Textilindustrie. Man muss die Dicken, und es werden immer mehr, beinahe für ihren Mut bewundern, der Einheitsästhetik schlicht und ergreifend Masse entgegenzusetzen. Aber wir wissen, dass dies mehrheitlich kaum aus rebellischem Elan geschieht. Längst wurde nachgewiesen, dass Adipositas ein Armutsvehikel ist.
Und je weiter wir uns von London entfernten, desto größer wurde der Kreis der Fettleibigen. Raststätten-Besuche sind offensichtlich für viele englische Familien das einzige Wochenendvergnügen. Hier verlassen die "big mamas" schon gar nicht mehr ihre PKWs, sondern bekommen den Triple-Burger von den Kindern hinter das Lenkrad gereicht. Das Mahl wird abgerundet durch eine Zigarette, derweil die Enkel auf der Rückbank tollen.
Oxford bietet das Gegenmodell – doch wieder nur für die Betuchten, was gar nicht mehr erwähnt werden muss. In angloamerikanischen Ländern existiert eine enge Verzahnung von Bildung und Sport. Teilnahme an letzterem ist in den Colleges obligatorisch, und kann in den USA sogar die Noten beeinflussen. Der Wettstreit unter den Oxforder Einrichtungen – viele von ihnen Gründungen aus der Renaissance – ist hart, und spätestens in den collegeeigenen Sportclubs werden Seilschaften für ein Leben in der Politik oder Hochfinanz geknüpft.
Der legendärste Kampf wird seit dem 19. Jahrhundert zwischen den Elite-Unis Cambridge und Oxford ausgefochten: Dromologie-Schlachten zu Wasser, mit Ruderblättern als Waffen und einem erbitterten Ehrgeiz, den sich viele Professoren – darunter unser Freund Paul Betts, der glücklich vor vier Jahren einen Ruf ans St. Antony's College erhielt – auch in die Studierstuben wünschten. Oxford hat hier den Heimvorteil des "großen" Flusses, denn trainiert wird auf der Themse, mit der das Flüsschen Cam bei der Konkurrenz nicht mithalten kann. Unser abendlicher Themse-Spaziergang zum hübschen Reihenhaus von Paul und Sylvie, das sich bei Besichtigung zu erstaunlicher Größe entfaltete, war erfüllt von den Rufen der Steuermänner und -frauen. Die Vorbereitungen für die Ruder-Regatta zwischen "Oxbridge und Camford" liefen auf Hochtouren, während links und rechts von uns auf dem Uferweg Jogger und Radfahrer vorbeijagten. Sport ist offensichtlich nach den Vorlesungen als körperliche Ertüchtigung angesagt und weniger als Spaß.
Wir wohnten malerisch, wenn auch recht laut in einer kleinen umgebauten Fabrik direkt an der Themse vor einem der Tore zur Altstadt. Oxford ist wie die meisten englischen Städte seiner Größe (ca. 150.000 Einwohner) und kulturellen Bedeutung prächtig erhalten. (Hitler-Deutschland gelang es "nur" einen Ort auszulöschen, und das war Coventry.) Die Kirchen, Burgen, Patrizierhäuser und Parkanlagen sind die Pfunde mit denen heute mehr denn je gewuchert wird, denn jeder Tourist spült Bares in die Städte; wobei nicht vergessen werden darf, dass die Pflege dieses reichen Erbes jährlich Milliarden verschlingt. Es ist also gut so. Auf die notorischen Touristengruppen (ein jeder Mitläufer ausgestattet mit Selfie-Konstruktion und Schirm) möchte man gleichwohl gern verzichten.
Die Stadt ist dem Studium und dessen bis heute unverzichtbarem Utensil, dem BUCH, geweiht. Dieser ruhigere Taktschlag war nach dem hektischen London willkommen. Der Konsumwahnsinn wird an Orten wie Oxford noch erfolgreich abgewehrt – allein, um das Stadtbild zu bewahren. Wir entdeckten ein Waterstone's unweit des Ashmolean Museums (des weltweit ersten Universitätsmuseums), das zwar auch zur größten Buchhandelskette der Insel gehörte, bei welchem aber, sehr sympathisch, auf die sonst übliche USP-Einrichtung verzichtet worden war. Er ist unvergleichlich dieser Duft alter Buchhandlungen, mit einer Basisnote aus Papier, Leim und Holzfußböden. Die Herznote ruht in Nuancen aus Menschenschweiß durch erhitztes Lesen und Blättern, daneben der Dunst trocknender Kleidung oder von Schirmen. Die Konzentration der Leser ist körperlich spürbar, das Gehirnschmalz beginnt bei dieser gewaltigen Verdichtung zu knistern und ist als kaum wahrnehmbares Fluidum für die Komplexität einer Kopfnote dennoch denkbar ungeeignet. Aber ich lasse mich gerade hinreißen, es war draußen recht windig und kühl. Eine vergleichbare Atmosphäre findet man in jedem Lesesaal älteren Semesters. –
Unser zuweilen kapriziöses Navigationsgerät führte uns nicht zum Autobahnzubringer, sondern, nachdem wir Oxford hinter uns gelassen hatten, auf eine Landstraße nach Schloss Blenheim. Wir waren der Lady in dem kleinen Kasten ausnahmsweise sehr dankbar für diesen Umweg. Denn keine Reise durch England darf absolviert werden, ohne dass man einen Park des genialen Capability Brown besucht hätte, der das Landschaftswesen im 18. Jahrhundert revolutioniert hat wie kein anderer – zunächst auf seiner Insel. Doch bald eiferten ihm vom Klein- bis zum Großadel alle nach, die es sich auch auf dem Kontinent leisten konnten: fort vom barocken Gartenideal Versailles, dessen launige Arabesken in gezirkelten Geometrien sich ohnehin am wirkungsvollsten aus der Höhe erschließen (hier kam Montgolfier mit seinem Heißluftballon als luftigem Transportmittel 100 Jahre zu spät), hin zu malerisch durchkomponierten Landschaftsbildern aus Waldhainen, künstlich angelegten Seen und Wasserfällen, über die sich romantische Brücken spannen, italienischen Parcours, mit Kletterrosen überwachsenen Hohlwegen und wie zufällig in die Parks gestreuten Ruinen und Skulpturen. Was sich in dieser Aufzählung kitschig anhören mag, sind raffinierte "Gemälde in der Natur" (deshalb höchstmöglicher Ausdruck von Kultur), durch die der Besucher wie in einer dreidimensionalen Animation wandelt. Allein, hier kann er Pflanzen und Blüten erriechen, den Wind auf der Haut spüren, sich um die eigene Achse drehen und in alle Richtungen an neuen "points de vue" dieser sorgfältig arrangierten Landschaftsgärten ergötzen. Einige der exotischen Bäume und Sträucher, die James Cook sowie andere Entdecker aus den künftigen Kolonien der Tropen heim ins Kingdom schifften, sind heute in Englands Schlossparks zu botanischen Giganten herangewachsen.
Die ganze gärtnerische Pracht am Blenheim Palace, dem größten nichtköniglichen Schloss Englands, wurde von den Herzögen von Marlborough in Auftrag gegeben, die eigentlich Churchill heißen. Der einflussreichste Sprössling, Sir Winston, kam hier zur Welt und schrieb zahlreiche seiner historischen Schriften, nobelpreisgewürdigt, an diesem Ort. Die Schlossgebäude wollen überwältigen, sind aber in ihrer Grandiosität kalt, gar ein wenig abstoßend.
Das Wunderbare aber bleiben die Parks von Capability Brown, der als Lancelot getauft wurde und dem Zeitgenossen den kuriosen Spitznamen verliehen, da er in seinem Metier der Fähigste war.
Eine lange Wegstrecke lag vor uns, gen Norden Richtung Yorkshire, wo wir Hockneys Landschaften realiter zu besichtigen uns vorgenommen hatten. Das Wetter meinte es gut, der berühmte Constable-Himmel wölbte sich über uns, schaumig blühender, wie mit Neuschnee überzogener Weißdorn begann allmählich die "hard shoulders", die Standspuren der Highways zu schmücken – nur der Linksverkehr, aber besonders das Schalten auf der linken Seite bereitete uns zunächst Mühe. Als ob wir versuchten, rückwärts Schwimmen zu lernen! Die letzte Mietwagentour von Liverpool bis in den Lake District von Cumbria und nach Glasgow lag zwölf Jahre zurück. O, wie waren wir damals noch jung und angstfrei! Was uns auf dieser Reise von unserem Ford Fiesta und seiner schwer gängigen Schaltung an Konzentrationsleistung abverlangt wurde, war beachtlich.
Am Nachmittag hatten wir unser Ziel erreicht, das alle Popaficionados aus dem Song von Simon & Garfunkel kennen; Marianne Faithfulls Version, die innigere, ist weniger geläufig: "Are you going to Scarborough Fair?" – Im Mittelalter war Scarborough (bei den Einheimischen schlicht: "Scar") für den Nordseehandel zwischen Skandinavien und Ostengland ein bedeutender Umschlagplatz und Messehafen. Natürlich hatten auch ihn die Römer begründet: Der heutige Burgberg eignete sich für Leuchtfeuer, die die Galeeren vor der schroffen, steilfelsigen Küstenlinie warnten, und herrlicher noch konnten Scars heiße Quellen den Söldnern kurzzeitig vorgaukeln, dass sie sich zu Hause befänden und nicht in der nebelig-feuchten Provinz Britannias. Diese Quellen sorgten auch dafür, dass sich Scar zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum mondänsten Seebad Europas entwickelte. Ja, so war es, nicht die Normandie, schon gar nicht die Côte d'Azur boten die ersten Bäder auf, sondern der hohe Norden Englands! Die "British nobility" entdeckte die Heilkräfte des Meerwassers (Thalasso) und der Quellen 1700 Jahre nach der römischen Besetzung erneut und nebenbei à la Grand Tour auch das Reisen ins Land, wo die Zitronen blüh'n.
Bei hellem Sonnenlicht wirkt fast jede Umgebung verheißungsvoll, doch manchen Orten verleiht die Sonne eine besondere Magie und dazu zählt Scarborough South Bay. Allerdings gilt es, zunächst zu unterscheiden zwischen Scarborough North und South Bay, zwischen den North und South Sands: Der Nordstrand wirkt im Vergleich recht bescheiden. Zwar ist dieser Strand bei Ebbe der größere, doch ist das Ambiente wenig attraktiv. Die Autostraße, die parallel zum Strand mit Dutzenden von Parkbuchten verläuft, kann das Gesamtbild nicht optimieren. Das beheizbare Schwimmbecken, vor hundert Jahren die Sensation der North Bay und ganz Englands, wurde gerade abgebrochen; das Grundstück wird derzeit umgemodelt in eine – was sonst? – Shopping Mall. Daneben sind am Nordstrand Häuser und Anlagen aus den vergangenen dreißig Jahren zu besichtigen; einzig etwas höher auf dem Kamm der Steilküste gelegen: eine typische britische Häuserzeile und ein altes Grand Hotel. Das gesamte Viertel hat einmal bessere Zeiten erlebt.
Wie auch der Südstrand als Zentrum Scars; doch lassen sich dem abgehalfterten Charme alter Seebäder durchaus nostalgische Déjavus abgewinnen. Erinnerungen an "unschuldige" Badeurlaube und Sommerfrischen flackern auf, selbst wenn man sie nur aus Spielfilmen kennt. Wie Capri von Anacapri durch den Monte Solaro getrennt ist, den man an der Nordküste des Eilands umfahren kann, so lässt sich auch der Südstrand, von der Nordstadt durch das oben genannte Burgfelsmassiv namens "Headland" geschieden, auf der Küstenstraße erreichen – und schon ist man in einer anderen Welt.
Der alte Hafen von Scarborough wurde in einen kleinen Jahrmarkt mit winzigem Riesenrad und anderen kindlichen Plaisiers umgewandelt. Diese Kirmesattraktionen gehören für den Briten zu jedem echten Urlaubserlebnis – ebenso die Bingohallen, Vergnügungstempel mit einarmigen Banditen und "slot machines" jedweder Bauart und Finesse. Für die einen der Alptraum, den sie mit Las Vegas verbinden, für die anderen Volksbespaßung, gesellige Zusammenkunft und nicht zuletzt DIE Möglichkeit, eine schmale Urlaubskasse aufzubessern. Dazwischen Cafés, Fish and Chips, aber auch das "Futurist", eine mittlerweile stillgelegte Veranstaltungshalle, in der die Beatles vor über 50 (fünfzig!) Jahren einen umjubelten Auftritt hatten.
Direkt vom Strand geht es hier hügelaufwärts in die Eastborough, die in die Fußgängerzone und Haupteinkaufsstraße der Westborough mündet. Abseits vom allgegenwärtigen Programm der Markenketten lassen sich in den Seitenstraßen einige kulinarische und weitere schräge Entdeckungen machen. Bei uns zum Beispiel nie gesehen: ein Taxidermist, in dessen Schaufenster sich allerhand ausgestopfte Vögel ausbreiteten und scheinbar zum Flug anhoben.
Über allem thront wie eine müde gewordene Fregatte, aber noch immer majestätisch, eines der ältesten (und für lange Jahre das größte!) Grand Hotels der Welt. Das Gebäude aus senffarbenen Ziegeln, im damals brandaktuellen Bombast der Neo-Renaissance (auch Second Empire genannt) gestaltet, wurde hoch über den South Sands auf den Steilfelsen von Scars Küste errichtet. Und es schaut exakt so aus wie der Name seines Architekten klingt: Cuthbert B(rod)rick! Steingewordene Synästhesie. Das Konzept klingt ähnlich verschroben. Das Haus funktioniert außen wie innen gemäß eines kalendarischen Plans: vier Türme für die Jahreszeiten, 12 Etagen für die Monate, 52 Schornsteine für die Wochen, ursprünglich 365 Zimmer – nur, dies detailliert zu erläutern, wäre ein eigener Text.
Bis nach Scar gelangte im Ersten Weltkrieg Admiral von Tirpitz' Flotte und beschoss die Hotel-Fregatte mit 30 Kanonenkugeln. Das war in den rund 150 Jahren ihres Bestehens die wohl härteste Anfechtung, auch wenn die Seevögel Dauersabotage betreiben. Seit der Eröffnung im Jahre 1867 führen die Hotelmanager einen harten, aber vergeblichen Kampf gegen die Möwenvölker, die die Verzierungen der Fassade auf ihre Weise schätzen. Jedes Gesims, jedes Türmchen, jede Zinne haben sie in Beschlag genommen, um dort zu brüten, sich zu unterhalten oder anzukeckern. Netze an der Fassade stören sie dabei keineswegs. Der Lärm ist mitunter infernalisch, weshalb die vielen Zimmer ohne Fenster, die das Hotel heute anbietet, wohl die teureren sein müssen. Aber bescheiden gefragt: Gibt es Küsten oder Strände ohne Möwen? Vielleicht auf einigen entlegenen Atollen im Pazifik. – Als beschauliche Unterkunft ist das Hotel mit seinen Flohmärkten für Handgehäkeltes, den Bingoabenden und Sangesdarbietungen sowie dem ununterbrochenen Möwengeschrei keinesfalls zu empfehlen.
Uli fand es in seiner gnadenlos kitschigen Inneneinrichtung, mit all den Gästen, die bei Musicals wie "Sound of Music" (die Trapp-Familie!) im "Edelweiß" schwelgten oder zu Beatles-Potpourris begeistert mitschunkelten, so herrlich schräg, dass er fast jeden Abend hinstromerte, um – natürlich, um mitzutingeln! (Hier gelangt die britische Populärmusik wieder zurück zu ihren Ursprungsorten, den Music Halls und deftigen Volksvergnügungen. Der Kreis schließt sich, den zu untersuchen einem anderen Text vorbehalten bleiben muss.)
Im Grand Hotel kreuzten sich gewissermaßen drei von Ulis Vorlieben: 1) die Begeisterung für das Design brut der DDR, dessen billig-praktisches Echo aus Kunststoffen, Aluminium, Schaumgummi, Melaminfurnieren und Pressspanplatten (bitte formaldehydgesättigt!) millionenfach in den USA und eben auch in England erschallt; 2) das Grand Hotel als Repräsentant der Ruinen-Romantik am lebenden Organismus, no fake, wie Trump echt gealtert und abgewetzt; 3) und last but not least der glückliche Mensch und Sangesbruder, der inmitten seines geliebten Clans Yorkshire Pudding, Roastbeef und Lemon Pie verspeist, sich bei Varieté-Klamauk und -Entertainment königlich amüsierend. Auch dafür liebe ich Uli!
Ich las derweil in unserem "Crown Spa Hotel" auf der Esplanade "Spoilt rotten! The toxic cult of sentimentality" von Theodore Dalrymple und beschäftigte mich bei dieser Lektüre im Grunde mit den selben Phänomenen.
Zum Grand Hotel führte einst eine der drei (3) Tramways des Südstrandes, von denen allerdings nur jene zur ehemaligen Kuranlage noch in Betrieb ist. Vergleichsweise sei hier erneut das schöne Capri herbeizitiert: Dort existiert eine (1) Funicolare, die den Hafen mit dem Marktplatz des Städtchens Capri verbindet. Scarborough strotzte für viele Jahrzehnte vor Luxus!
Eine parabelhaft geschwungene Eisenbrücke hilft dem Fußgänger, die Schlucht zwischen den Steilküstenabschnitten zu überwinden. Auf dem südlicher gelegenen finden sich weitere alte Grand Hotels, darunter unser "Crown Spa". Elegante viktorianische Häuserzeilen bieten ihren glücklichen Bewohnern oder den Hotelgästen einmalige panoramatische Ausblicke aufs Meer, den Hafen mit Altstadt oder auf die weiter südlich beginnenden, kaum besiedelten Felsen. An dieser Stelle wurde die Steilküste in einen Kurpark verwandelt, dessen Themenbereiche über endlos sich erstreckende Serpentinenwege erschlossen werden können.
Am Strand darunter liegt das alte Kurzentrum. Seine Quellen verhalfen Scarborough einst zum Titel "Bad" ("Spa"). Die alte Anlage wurde durch einige Anbauten in den 1970ern in ihrem Fin de Siècle-Charakter arg lädiert. Sie ist ohnehin nicht mehr in Betrieb, dient als Veranstaltungsort und hat neben einer Sonnenterrasse noch ein größeres Café zu bieten. Bei Flut wird das Kurhaus dramatisch von Gezeitenwellen bedrängt.
Im Sommer werden hier u.a. Mick Avory, der ehemalige Schlagzeuger von den KINKS, mit seiner neuen Formation und Jools Holland, formerly member of the SQUEEZE, auftreten. In der Arena an den North Sands hatte sich zudem der unverwüstliche Cliff Richard angekündigt. Während ich die Plakate studierte, wurde ich einmal mehr von jenen Sentiments überwältigt, über die ich gerade las: solchen nostalgischer Natur und solchen des Schreckens. Leiden die Idole unserer Jugend nicht Tantalusqualen, wenn sie immer und immer wieder dieselben Songs zum Besten geben – bis ans Ende ihrer Tage? Darauf folgte sogleich der Gedanke, dass in Kirchen seit Jahrhunderten mehr oder weniger inbrünstig Liedtexte von Paul Gerhardt gesungen werden, an Lagerfeuern der Jugendherbergen vermutlich noch immer die Mundorgel kursiert und sich eine Melodie wie die oben genannte "Are you going to Scarborough Fair?" durch Jahrhunderte als "traditional" in unsere Zeit hinüber rettete. Es bleibt eine Sache der Einstellung. Ist es erfüllend, anderen Menschen Freude zu bereiten, selbst wenn (oder gerade weil) sie das Repertoire in- und auswendig kennen? Eines ist sicher: Würden die BEATLES diesen Sommer in Scars "Futurist" auftreten – ich würde sogar zu Fuß hinlaufen.
Der Strand von Scar war extrem sauber, was sich in der Hauptsaison vermutlich drastisch ändern wird. Die Nordseeküste weist hier einen gekörnten dunkelgelben Sand auf, der bei entsprechendem Licht golden schimmert. Überhaupt das Licht! Scheint die Sonne, ergeben sich bei zurückgehender Flut auf noch nassen Sandflächen zauberhafte Spiegelungen von Altstadt und Hafen. Die Vormittage am Strand, in den Parkanlagen oder auf der Esplanade waren im morgendlichen Leuchten der Ostsonne einfach wunderbar. Wir mussten uns ein übers andere Mal in Erinnerung rufen, wo wir uns eigentlich befanden: unweit der schottischen Grenze an der Ostküste Nordenglands! Und dennoch wähnt sich der steppwestenwattierte Flaneur – verzückt über Lichtspiele und gleißendes Meer – beinahe an der Küste Amalfis! Die Nordsee reflektiert die Morgensonne millionenfach auf ihren Wellenkämmen und liegt in der leicht gekippten Steilküsten-Perspektive wie ein funkelnd bewegter Teppich vor dem Betrachter. Der Südstrand von Scarborough gehört zu den schönsten Buchten, die wir je gesehen haben! Und wir sahen wenige.
Sehr angenehm, dass der Autoverkehr an der südlichen Strandpromenade ab der Eisenbrücke bis auf Busse und ein Manövrieren weniger PKWs eingestellt wurde. Vom Kurhaus aus begleiten den Strand ohnehin nur noch Fußwege, die schließlich den Hang hinauf zum Heideweg über die Steilklippen nach Filey führen. Der ist nichts für Zauderer; hier muss man wahrhaftig "gut zu Fuß" sein. Weshalb wir gleich das Auto benutzten, um über Filey weiter südlich nach Bridlington zu gelangen. Beeindruckender als dieser gesichtslose kleine Hafen, den David Hockney für viele Jahre zu seinem Arbeits- und Wohnort gemacht hatte, waren die landeinwärts gelegenen Yorkshire Wolds, in denen er Landschaften malte oder filmte: die Schwingungen der Felder auf sanften Hügeln im Wechsel mit Waldstücken und Dörfern, stets rhythmisiert durch die Hecken seines geliebten "hawthorne", dem zuvor beschriebenen Weißdorn. Der gedeiht zwar auch bei uns, doch hat er in England seit Jahrhunderten die Funktion, Felder zu trennen und die wertvolle Ackerkrume vor den heftigen Winden der Nordsee zu schützen.
Wir hatten noch am selben Tag die Kraft, der Langeweile Bridlingtons die Schwermut Whitbys entgegenzusetzen. Zwanzig Meilen nördlich von Scar liegt an der Mündung des Esk die kleine Fischereistadt, deren Architektur an norwegische Küstenorte gemahnt. Wahrzeichen ist die hoch über dem Hafenbecken ruhende Klosterruine, St. Hilda geweiht, die irgendwann aus einem Gemälde von Caspar David Friedrich auf diesen Hügel an der Nordsee teleportiert worden sein muss. Der 200 Jahre alte Friedhof mit seinen Aberdutzenden von verwitterten Grabsteinen unmittelbar neben der Ruine sowie der düstere, ja abweisende Charakter der Stadt inspirierten Bram Stoker, hier seine Romanfigur Dracula anzusiedeln. Whitby ist deshalb heute ein Wallfahrtsort für Grufties und Gothic-Fans geworden, aber auch begehrte Kulisse für Horrorfilme. Die endlose Heidelandschaft vor Whitby wird regelmäßig abgefackelt, um zu verhindern, dass sich durch Samenflug heidefremde Pflanzen ansiedeln. Brandkeimer wie Heidekraut, Ginster und andere Arten überleben das Feuer unter der Erde. Die verkohlten rußigen Flächen, akzentuiert von Findlingen, erweitern Whitbys Drehorte um bizarr-gruselige "locations".
Der interessantere Ausflug von Scar führte uns gen Westen nach Bradford bei Leeds mit anschließender Stippvisite in York. Es war eine Reise in das Herzland der Industriellen Revolution. Doch hier floriert schon lange nichts mehr, seit die Märkte sich nach Asien verlagert haben und Englands traditionelle Produktionsstätten für Stahl und Textil aufgeben mussten. Die Digitalisierung hat unserem alten Europa schließlich den Genickschuss verpasst. Was bleibt, sind Tourismus, Dienstleistungen und der Umbau historischer oder industrieller Stätten in "wertvolle" und familienkompatible Erlebnisorte. (Nordrhein-Westfalen schreitet voran!) Bradford besitzt nicht nur das größte Medienmuseum des Königreichs, in dem wir uns die Moholys der fotografischen Sammlung und die aktuellen Ausstellungen anschauten. In Bradford wurden in den 1930ern auch die ersten Einwohner aus Ländern des Commonwealth angesiedelt, vorwiegend Pakistani. Die schweren Rassenunruhen 2001 unter Bradfordians asiatischer und englischer Herkunft berichten von einer wenig gelungenen Integration. Von welcher Malaise wir im Mai 2017 nichts bemerkten; die Stadt schien sediert bis hin zu einem Zustand frühsommerlicher Paralyse. – Bradford besitzt auch eines der schönsten Industriedenkmäler in Gestalt der ehemaligen Textilfabrik von Titus Salt. Der befand im 19. Jahrhundert, dass eine vorteilhafte Arbeitsumgebung in gediegener Architektur seine Arbeiter zu Höchstleistungen stimulieren könne. Der Erfolg gab ihm Recht. Heute gehört die Anlage dem Textilkaufmann Jonathan Silver, der sie zu einer kulturellen Begegnungsstätte umbaute, die nicht nur von Bradfords alter Textiltradition kündet, sondern darüber hinaus von Silvers künstlerischen Vorlieben. In Bradford, dem Geburtsort David Hockneys, ist Silvers Privatsammlung dem berühmten Sohn der Stadt gewidmet. Unsere Freude ist, wie soll ich sagen, wahrhaft grenzenlos gewesen angesichts dieses reichhaltigen Desserts, das uns nach der Tate Britain-Retrospektive serviert wurde. Zumal keiner unserer Reiseführer über diesen Umstand Auskunft gab. Überraschungen dieser Art sind für "culture vultures" Höhepunkte jeder Büldungsreise.
In York möchte man sich niederlassen. Getreu Sinatras Liedtext über NEW York "... if you can make it there, you'll make it anywhere..." sollte man sich hier nach einem aufregenden Jahrzehnt in Manhattan zur Ruhe setzen. Die 140.000 Seelen zählende Stadt hat alles, was den leicht angegrauten Großstädter glücklich macht: Universitäten, Studenten, Kultur, Ruhe und Gelassenheit, ein unversehrtes mittelalterliches Stadtbild, den Fluss Ouse vor den Stadtmauern und die Nähe zum Meer. Bis nach Scar sind es ganze 35 Meilen.
UNVERSEHRT ist ein Adjektiv, das uns in Deutschland, dem unheimlichen Reich der Heimatanbeter, Kriegserklärer, Völkermörder und Sentimentalisten, in dem kaum ein Platz, ein Dorf, eine Stadt von den auf unserer Seite angezettelten und mit allem Völker-Recht verlorenen Kriegen des vergangenen Jahrhunderts verschont blieb, selten in den Sinn käme, um Orte zu beschreiben. York ist so unversehrt, dass es einen Deutschen zu Tränen rührte, würde er nicht gerade Dalrymple gelesen haben, mit dessen Hilfe das fataldeutsche Pendel zwischen Idealismus und Rationalismus eindeutig zu letzterem hin ausschlagen muss.
Und dennoch bleibt dieser kleine Rest an Miss Marple-Sehnsucht, in dem die knurrige alte Dame nervenstark, mit amateurdetektivischem Furor und grandiosem Mutterwitz bösen Buben den Garaus macht, auf dass Tudor-Fachwerk und Rosengärten wieder einwandfrei funktionieren. Doch vergessen wir nicht: Gerade unter der Haube des pittoresken, moralisch sauberen Englands der "budding English roses" und des "fair play" nistet das Böse. Sensiblen Gemütern möchte man deshalb unbedingt von der englischen Serie über den "Yorkshire Killer" abraten. In allen Nationen tun sich menschliche Abgründe auf; es geht darum, Methoden zu entwickeln, diese unter Verschluss zu halten. England hat die Zivil-Gesellschaft erfunden, die parlamentarische Demokratie, das Recht auf uneingeschränkte Entfaltung des Individuums. Dafür schulden wir England Dank und England uns eine Zweitwohnung in York!
Die Insel sei zu klein für all die Leute, die Zutritt begehrten, wurde uns in Scar von einem Hotelier-Pärchen beschieden, das für den Brexit gestimmt hatte. Gut, neben ihnen und den Londonern Sandra und Dominic (sie Schottin mit italienischen Wurzeln, also im Grunde eine doppelte Ausländerin) sowie dem Hotel-Personal im Norden begegneten uns in der Tat fast ausschließlich Angestellte, deren gebrochenes Englisch dem unseren kaum nachstand. Der Dienstleistungssektor wird in London fast vollständig von Zugereisten bestellt. Aber ist es nicht inzwischen ein globales Phänomen, dass die Eingeborenen westlicher Industrienationen sich zu niederen Diensten kaum noch herablassen? Ein Allgemeinplatz, dass Spargelernte oder Weinlese bei uns von Arbeitern aus den ehemaligen Ostblockstaaten ausgeführt werden. Wenn Polen sich in England als findiger und fleißiger erweisen, sind sie plötzlich Buhmänner, die argwöhnisch beäugt oder gar angegangen werden. Die Menschen sind überall gleich, das Fremde ist eine Gefahr, Besitzstände müssen verteidigt werden, Stämme und Clans wollen unter sich bleiben. Auf das Terrain der monotheistischen Religionen, die angeblich alle zu dem einen Gott beten, möchte man sich gar nicht erst begeben. Es ist schwer, und wie sagt Bazon Brock? Wir können einander nicht verstehen, sondern nur missverstehen. Seit Menschengedenken wird deshalb um Kommunikation gerungen. Dass Lumpen wie Nigel Farage von der UKIP, die inzwischen nicht mehr existiert, gleich nach der populistischen Hetze, das sinkende Schiff verlassen haben, sagt alles. Die Früchte dieses Zorns haben nun andere aufzusammeln und zu verarbeiten.
Das Schlusswort sei drei Ladies gewidmet, die in Scar das hoch gelobte "Mother Hubbard"-Restaurant an der Westborough betreiben und so blond und blauäugig, wie sie uns entgegentraten, ganz offensichtlich dänisch-wikingischen Ursprungs sind, nach den Römern weitere Invasoren der Insel. Die Hubbard-Frauen – Mutter und zwei Töchter –, die mit Ron nichts zu schaffen haben, aber wegen ihrer Kochkünste mindestens in den Rang der "Kulinaria-Org" erhoben werden sollten, haben uns vier Tage lang liebevoll mit dem Besten der britischen Fish and Chips-Küche "gefüttert", und hier erfuhren wir, dass ausschließlich der haddock = Schellfisch die Nationalküche adelt. Nun noch der Limerick, dann sind wir durch:
Mom Hubbard's kitchen doors ajar, there've been three ladies in Scar,
Scents of fish in the air, our ladies' heads so golden and fair!
We'll return to the balms, pounds in our palms, if Scar only wasn't so far!
Eight days a week in England for Uli and Jeannine (Berlin, Juni 2017)
*Ich bin beim Schreiben vom aktuellen Grauen eingeholt worden, das von anderen Daten kündet. Sie verbannen die Armen auch in Türme mitten im stinkreichen Kensington, die so skandalös ungesichert sind, dass sie nicht einmal den Mindeststandards bei Brand- und anderen Unglücksfällen genügen. Man möchte sich in Grund und Boden schämen. Es sollten 5,000 Britische Pfund eingespart werden!
Analog zu den Geschlechtertürmen in der Toskana sollte heute also nicht von Armenhäusern, sondern von Armentürmen gesprochen werden.
Dienstag, 27. Juni 2017
England im Mai 2017
Letzte Einträge
WUNDERBLOCK
Farbig oder monochrom? Der Roman "Blaupause" von Theresia Enzensberger
England im Mai 2017
Cote d'Azur im November 2015
Von der Uneigentlichkeit des Seins, sozusagen
Satans Spielfeld, Roman von Ute Cohen, 2017
Annelies Strba, "Hiroshima mon amour", 1994
Comrades of all nations, Freunde, femmes et hommes de la rue, companeros, amici -
Freunde, comrades of all nations, femmes et hommes de la rue, companeros, amici -
Balanceakte und artistische Infanten. Equilibristen auf der Schaukel ratlos