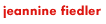Die Sonne ist von Wolken verdeckt, die als dichte undurchdringliche Masse über einer Parklandschaft liegen und ihr nur ein fahles Licht schenken. Wir wähnen uns einer unspektakulären Situation gegenüber, so alltäglich wie schön: Ein Pärchen, nehmen wir an, es sei ein Liebespaar, sitzt auf einer Bank am Rande dieses Parks. Eher ruht es kontemplativ, in sich gekehrt die Haltung des Mädchens und des jungen Mannes. Wäre da nicht, nahe bei ihnen, als Fortbewegungsgefährt ein Motorrad an der Bordsteinkante geparkt, das auf ihre Jugend verweist, wir könnten versucht sein, sie für die Idee vom Paar schlechthin zu halten, alterslos, stumm kommunizierend. Hier sei ein Grad an gegenseitigem Verständnis erreicht, so würden wir weiterhin vermuten, der jede expressive Gebärdensprache schon vor langer Zeit überflüssig machte. Das wunschlose Beisammensein im Alter. Ein Pärchen, irgendwo auf dieser Welt in irgend einem Park – drei Bänke von ihm entfernt ein einzelner rastender Spaziergänger. Es herrscht Winter. Oder der Frühling steht unmittelbar bevor. Auch die Natur scheint zu ruhen.
Wir entdecken den Titel des Bildes von Annelies Strba – "Hiroshima mon amour". Unserem Blick wird von der einen Sekunde zur nächsten die Gewißheit der ewigen Wiederkehr des Immergleichen entzogen...all jene Liebespaare, eine stete Wiedererfindung der Liebe, die alljährliche Entfaltung der Natur. Unser Blick wird plötzlich von dem Allgemeinen auf das Besondere der Erkenntnis gelenkt: für Menschen in Hiroshima muß ein Normalzustand, ein Denken ohne die Formeln und Erinnerungszwänge der Geschichte oder einfach die Gegenwart auch fünfzig Jahre nach der keinen Widerspruch zulassenden Maßregelung ihrer Nation durch die andere noch immer dem Alltag abgerungen werden.
Gab bis hier die Phantasie unseren Gedanken und Erfindungen die Schubkraft, so zwingt uns der Titel nach der Filmvorlage von Marguerite Duras (der Film von Alain Resnais erschien 1958, dreizehn Jahre nach der Katastrophe) die Gewalt von Geschichte und Wirklichkeit auf. Doch aus der Polarität zwischen der Kraft unserer Einbildung und der Macht der Geschichte zieht Strbas Komposition, die zunächst als alltägliche Beobachtung ins Blickfeld gerät, ihre innere Spannung. Eine Spannung nicht zuletzt zwischen Bild-Wahrnehmung-Gefühl und Buchstaben-Wissen-Vernunft.
Den Dingen ihre Natur, dem Leben die Wärme zurückzugeben, die ihnen durch die Hitze des atomaren Vergeltungsschlags im Fernen Osten und in den Krematorien des europäischen Ostens abhandenkam, ist das große Projekt der Nachkriegszeit, dem sich besonders die Künstler verschrieben haben. Wenn mit Benjamin der Blick die Neige des Menschen ist, so ist folglich der Blick auf Hiroshima die Neige der Menschheit. Der Fotograf und Künstler ist Sammler unserer Blicke, ihrer Reste und ihrer Begrenzungen. Alles, was unbegreiflich ist, hört nicht auf zu sein. Manche Schrecken, die Menschen unter Menschen verursachen, sind so unfaßbar, daß wir nicht anders können, als uns mit ihnen zu beschäftigen. "Bedauerlich ist aber, daß die politische Intelligenz des Menschen hundertmal weniger entwickelt ist als seine wissenschaftliche Intelligenz.", zu lesen auf einem Plakat in Hiroshima.
Fast alle Arbeiten Strbas eint, das Intime im urbanen Raum und das gesellschaftliche Kraftfeld im Privaten aufgespürt zu haben. Feine Häutungen im zufälligen Miteinander ihrer Familie – zwischen Küche und Stube, zwischen Wachen und Traum – eine nie endende Fotoarbeit in Jahresringen; ephemere Schichtungen von Häusern, Gebäuden, Straßenfluchten, die Schleier der Landschaften; alles ist durchdrungen von einem Blick, der zwischen einem Politischen und einem Persönlichen, das uns drinnen wie draußen in der Welt gleichermaßen kennzeichnet, nicht trennen will.
Montag, 22. August 2016
Annelies Strba, "Hiroshima mon amour", 1994
Letzte Einträge
WUNDERBLOCK
Farbig oder monochrom? Der Roman "Blaupause" von Theresia Enzensberger
England im Mai 2017
Cote d'Azur im November 2015
Von der Uneigentlichkeit des Seins, sozusagen
Satans Spielfeld, Roman von Ute Cohen, 2017
Annelies Strba, "Hiroshima mon amour", 1994
Comrades of all nations, Freunde, femmes et hommes de la rue, companeros, amici -
Freunde, comrades of all nations, femmes et hommes de la rue, companeros, amici -
Balanceakte und artistische Infanten. Equilibristen auf der Schaukel ratlos