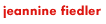Aus den Bilderwelten der Künstlerin Ursula Rosinsky
Wer kennte es nicht? Andersens Märchen vom standhaften Zinnsoldaten, in welchem die Spielzeuge der kleinen Buben und Mädchen des Nachts zum Tanze aufrufen – ein für Menschenaugen unsichtbares Spektakulum – und darüber in ein solch loderndes Gefühlsleben geraten, dass sich zum grausam-schönen Ende hin der Zinnsoldat und seine angebetete Tänzerin in den Flammen des Kaminfeuers vereinen.
In ähnlich magische Gegenwelten entführt uns die Stuttgarter Künstlerin Ursula Rosinsky mit ihren Bildern. Und wie im Märchen so geht es auch auf ihnen nur im ersten Augenblick beschaulich zu. Bevölkert werden sie von allerlei Getier, vorzugsweise von jungen Hunden, die sich Dosen, Schachteln und andere Objekte des Alltags sowie ausgestopfte Bären oder Hasen zu Kameraden erkoren haben. Und von Kindern, kleinen und großen Mädchen, und ihren Puppen, bunt gewandet oder nackt auf Regalen und in Schaukästen ihrer Erweckung harrend.
Die weiblichen Statisten – ob Kindfrau oder puppenhaftes Schemen ausgestattet mit gedrungenen, altklugen Leibern – scheinen leise listig bis offen frivol hinter Kulissen, die die Künstlerin uns vorenthält, die Rollen zu tauschen zur heillosen Verwirrung der Betrachter. Erstaunen macht sich breit auf runden Gesichtern und in riesigen Augen, die uns scheinbar taxieren, doch bei genauerer Befragung durch uns hindurch starren in einen nur ihnen bekannten Kosmos. An dieser Introspektion sind wir so wenig beteiligt wie an ihren womöglich abgründigen Spielen, entdecken wir doch mitunter eine unverhohlene Lust am gelungenen Täuschungsmanöver.
Eins vor, eins zurück, im Ausfallschritt zwischen kindlicher Imagination und kalkulierten, sehr erwachsenen Dressurakten. Hier und da ein Fingerzeig auf Perversionen im Puppenparadies: die Peitsche in der Hand einer pummeligen Mädchenamazone, die ihren Kuschelteddy Mores lehren wird; eine umgerissene, nun auslaufende Nuckelflasche verweist auf die Eifersucht des treuen Hundegefährten; der Fischkadaver im Buddeleimer des nackten Nymphchens lädt ein zu Masturbationsphantasien. Die Balance zwischen Naivité und (sexueller) Abgeklärtheit, zwischen vordergründiger Puppenstubenunschuld und den Untiefen einer Bewusstseinswerdung ist labil und von äußerst delikater Handhabung, so möchten uns die schweigenden Münder mitteilen. Tiere wie Kinder bilden eine gleichsam verschworene Gemeinschaft wider die Regeln einer fremden, einer erwachsenen Welt, die sie gleichwohl perfekt beherrschen – und das ist ihr Trick.
Von Abnabelungsprozessen und heiklen Schwebezuständen erzählt Rosinskys "Schaukelserie". Die vornehmlich weiblichen Figuren befinden sich in feinnerviger Anspannung akrobatisch pendelnd zwischen den Lebensaltern. Der malerische Gestus versetzt die figürliche Staffage hier ebenso wie in den "Badebildern" oder in den "Ladeneinrichtungen" in ein gleichsam 'enträumlichtes' kompositorisches Bildgefüge. Die Etablierung ihrer völlig unsentimentalen Gegenwelten gelingt der Künstlerin durch eine Entkernung der Kompositionen von jeglichem narrativen Gerümpel. Zum Inventar der Bilder gehören wenige, oft nur angedeutete Objekte wie Seile, Leitern und Griffe, die, ohne je ihre Verankerung sichtbar zu machen, in die Komposition ragen. Vor farbig-pastosem Grund vollzieht sich in der Überwindung von Zeit und Raum die Sublimation von emotionalen Zuständen und Lebenszyklen. Ohne doppelten Boden oder Erdung in dechiffrierbaren Zeichensystemen scheinen sich Rosinskys kleine Heroinen zur Verblüffung des Betrachters ihr Equilibrium selbst im Balanceakt geschaffen zu haben.
In Rosinskys autopoetischen Werkzyklen regiert der "ikonographische Imperativ" und hält das Spiel der Sinnschichten in einem fragilen Gleichgewicht. Obwohl sich aus ihren Arbeiten kein direktes Echo auf den Magier des Gegenständlichen, den Maler Balthus, formt, so findet auch sie ihre ästhetische Position in der Abstinenz vom Abstrakten. Von den Avantgarden des 20. Jahrhunderts immer wieder für tot erklärt, wird der veristische Stil im malerischen Metier inklusive seiner Verrätselung durch die jeweiligen Zeitläufte einmal mehr vom Publikum durch besondere Zuwendung geadelt. (Zwei aktuelle Ausstellungen in Frankfurt/Main demonstrieren dies.)
Dieser zunächst 'inhaltliche' oder stilistische Widerspruch der Schülerin zu ihrem Meister an der Stuttgarter Akademie der Künste, K.R.H. Sonderborg, dessen dynamische Schwarzweißbilder sich aus dem abstrakten Expressionismus herleiten, findet im flächig-energischen Strich der Künstlerin, im Werkcharakter seine Aufhebung. Auf unterschiedlichsten Bildformaten – von der Miniatur bis zum wandfüllenden Gemälde – und in der bevorzugten, rasch trocknenden Eitempera-Technik, die den trotzigen oder selbstvergessenen Posen ihrer kleinen Darsteller ein 'hard edge', eine unbewusste Härte verleiht, dominiert ein schwungvoller Duktus die Kompositionen. Deren Struktur, die Wahl der Farben und der wenigen Muster wird manches Mal sichtbar korrigiert und verleugnet nicht eine gewisse Unfertigkeit oder Prozesshaftigkeit der Arbeit. Hier wird die Künstlerin eins mit der Entourage ihrer Werke: auf der Suche nach einer unvollendeten Vergangenheit oder schon beschlossenen Zukunft.
Berlin, 2002
Montag, 22. August 2016
Balanceakte und artistische Infanten. Equilibristen auf der Schaukel ratlos
Letzte Einträge
WUNDERBLOCK
Farbig oder monochrom? Der Roman "Blaupause" von Theresia Enzensberger
England im Mai 2017
Cote d'Azur im November 2015
Von der Uneigentlichkeit des Seins, sozusagen
Satans Spielfeld, Roman von Ute Cohen, 2017
Annelies Strba, "Hiroshima mon amour", 1994
Comrades of all nations, Freunde, femmes et hommes de la rue, companeros, amici -
Freunde, comrades of all nations, femmes et hommes de la rue, companeros, amici -
Balanceakte und artistische Infanten. Equilibristen auf der Schaukel ratlos